Ein Beitrag von Monika Zöller-Engelhardt, Sarah Scoppie, Stefan Schreiber und Tina Beck
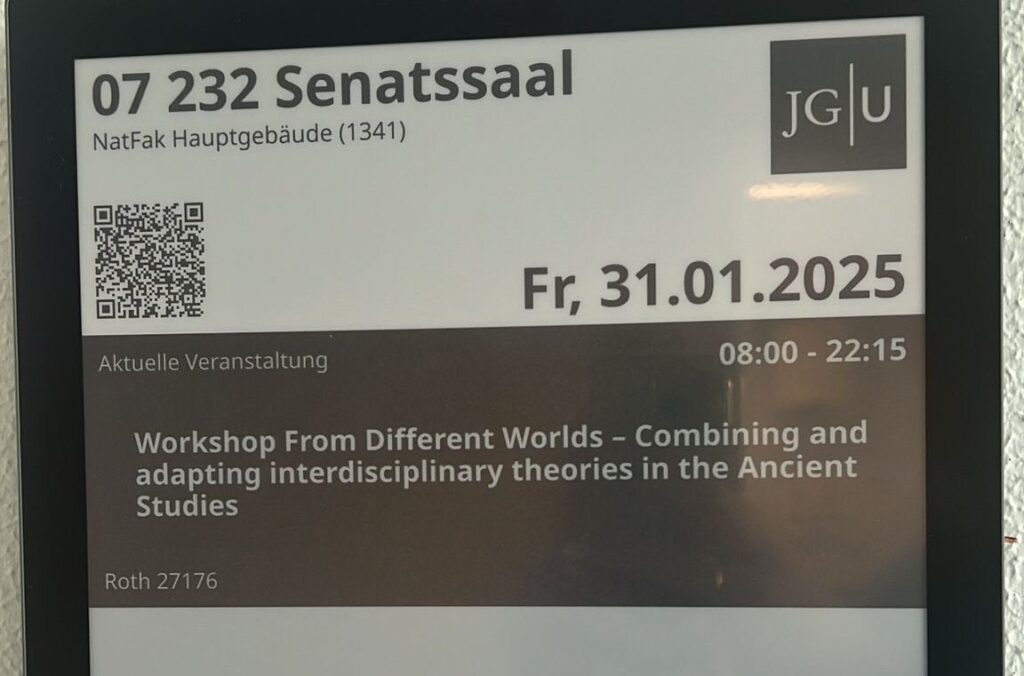
31.01.2025–01.02.2025
Gemeinsamer Workshop des Profilbereichs „40,000 Years of Human Challenges“ an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Workshop-Reihe der AG TidA „Theory in Practice“ und des Arbeitsbereichs Ägyptologie des Instituts für Altertumswissenschaften
Organisation: Monika Zöller-Engelhardt, Sarah Scoppie, Stefan Schreiber, Tina Beck
Nach einer thematischen Einleitung durch Monika Zöller-Engelhardt im Namen des Organisationsteams arbeitete Kerstin P. Hofmann in ihrem umfassenden Keynotevortrag heraus, welche Forschungsschwerpunkte die Altertumswissenschaften im Vergleich zu anderen Disziplinen behandeln und machte dies explizit aus der Perspektive einer prähistorischen Archäologin. Sie veranschaulichte sehr gut, dass „Archäologien“ im Gegensatz zu anderen Disziplinen sehr breite Untersuchungsfelder mit großer zeitlicher Tiefe umfassen und widerlegte den Eindruck, Altertumswissenschaften würden Theorien ausschließlich aus anderen Forschungsfeldern übernehmen. Sie stellte fest, dass Nutzung und Adaption von Theorien fachfremder Disziplinen einer Übersetzungsleistung unterliegen und damit kein Schlüssel-Schloss-Prinzip darstellen, sondern als (subjektive) Interpretationen zu verstehen sind. Diesem Plädoyer für Theorien in der Archäologie und für die Kombination dieser folgten sieben konkrete Anwendungsbeispiele aus den Altertumswissenschaften [1].

Raphael Berger stellte in seinem Beitrag die Formale Netzwerkanalyse und die Akteur*innen-Netzwerk-Theorie vor, die er im Rahmen seiner Dissertationsforschung zur Thunerseeregion verbindet. Mit diesem posthumanistischen Ansatz möchte er in der prähistorischen Archäologie traditionelle Perspektiven und Forschungen aus kapitalistischer Perspektive zu Handelsnetzwerken überwinden, um eine Alternative vorzuschlagen. Susanne Deicher rückte die Forschung von Erich Auerbach zur „Figura“ in den Vordergrund, bettete diese in die Forschungsgeschichte der Kunst-, Kultur- und Geisteswissenschaften ein und brachte sie mit Phillippe Descolas jüngerer Forschung zur „Figur“ in Zusammenhang. Anhand altägyptischer Fallbeispiele illustrierte sie den Vorteil eines solchen Figurbegriffs, der nicht funktionsgebunden, sondern deterministisch ist. Mirja Biehl stellte die Cognitive Science of Religion vor und lenkte das Augenmerk auf die Theorien Minimally counterintuitive concepts und Hyperactive agency detection und deren Verbindung zur Religion der griechischen Antike. Sabine Neumann fokussierte auf das Konzept des social imaginary für antike Religionen. Rituelle Praktiken werden mit Vorstellungen und Glauben verbunden, um so Akteur*innen sichtbar zu machen. Johannes Bach stellte in seinem Vortrag die Frage, wie man Theorie angemessen auf assyriologische Texte zur antiken Historiografie anwenden könne. Hierfür stellte er unterschiedliche Theorien der Geschichtsschreibung vor und brachte diese mit königlichen Texten zusammen, wobei er für eine selbstkritische, reflektierte Vorgehensweise bei der Anwendung/Übernahme/Übersetzung der Großtheorien der Geschichtsschreibung plädierte. Shumon T. Hussain beschäftigte sich mit Technologie und Ökonomie und stellt den Begriff der Technosphäre vor, was u. a. alle Artefakte (vom Menschen hergestellte Dinge) umfasste und einen neuen Analyseblick auf Steinwerkzeuge evozierte. Im letzten Vortrag des ersten Workshop-Tages reflektierte Stefan Schreiber die Nutzung von Theorien durch die vermeintlich gegensätzlichen Konzepte des Parasitären und der Solidarität. Dazu führte er in die Perspektive der Fadenspiele ein, welche auf Donna Haraway zurückgeht, um beide Konzepte zusammenzubringen und einen Blick auf gemeinsame Theoriearbeit jenseits von Disziplinengrenzen öffnet.
Nach den Vorträgen folgten konstruktive und lebhafte Diskussionen, die auch in den Pausen fortgeführt wurden. Am Abend ergaben sich hieraus erste Ideen, die als Ansatzpunkte für das Barcamp-Format des nächsten Tages dienten, die auf einem Barcamp-Board organisiert wurden. Der zweite Workshop-Tag widmete sich gänzlich den Barcamp-Diskussionrunden an Gruppentischen, vorab eingeleitet durch zwei Spotlight-Vorträge: Monika Zöller-Engelhardt stellte am Beispiel altägyptischer Grabanlagen die Übertragung des Konzepts der Sorge in Verbindung mit dem Konzept der Affordanz vor. Tina Beck problematisierte am Beispiel des Begriffs entanglement die unreflektierte Nutzung von Theorien durch ein vermeintlich allerklärendes Schlagwort.
Auf dem Barcamp-Board wurden die von allen Teilnehmenden gemeinsam erarbeiteten zahlreichen Stichpunkte zu vier übergeordneten Themenbereichen geclustert: (1) Bildsprache, Gesellschaft, Imaginäre Wirklichkeit, Kognition, Ontologie und World-making; (2) Anwenden von Theorie, Universaltheorie, was ist Theorie, Nutzlosigkeit von Theorie; (3) Data Science, Rolle von Datenbanken in der Theoriebildung, (4) Entanglement, Sorge-Konzept, Mensch-Ding-Verflechtungen. Für die erste Barcamp-Runde wurden drei Diskussionsgruppen zusammengestellt. Die Teilnehmenden priorisierten auf dem Board die Themen, die sie zuerst diskutieren wollten. Für die erste Barcamp-Runde wurden die Themenbereiche 1 und 4 gewählt, wobei Thema 4 in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Die Ergebnisse der Diskussionen der einzelnen Barcamp-Gruppen wurden durch Poster oder Moderationskarten festgehalten. Es zeigte sich, dass die Diskussionen in ganz unterschiedliche Richtungen gingen und verschiedenste Möglichkeiten und Szenarien der Theorienutzung aufzeigten. Bemerkenswert war, dass sich die Diskussion der beiden Barcamp-Tische zu Entanglement bzw. Mensch-Ding-Verflechtungen in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelten: Während eine Gruppe hauptsächlich Ian Hodders Forschung in den Vordergrund stellte, fokussierte die zweite Gruppe auf das Konzept der Sorge und leitete so zur Emotionsforschung über, welches als neues Thema (5) Emotionen für die anschließende Barcamp-Runde vorgeschlagen wurde. Für die zweite Barcamp-Runde wurden die Themen 2, 3 und 5 diskutiert.
Der Keynotevortrag, die Einzelvorträge und Spotlights sowie die kontroversen Diskussionen zeigten, dass die interdisziplinäre Kombination und Adaption von Theorien in den Altertumswissenschaften unerlässlich ist und zahlreiche Anknüpfungspunkte für zukünftigen Austausch offenließen.
[1] Der angekündigte Vortrag von Matthieu Götz entfiel krankheitsbedingt.

